Vor ein paar Jahren bekam ich eine Mail von einer Journalistin, die sich mit mir über meine polnische Biografie unterhalten wollte. Ihr Name war Emilia Smechowski und sie schrieb für die taz. Zu dem Zeitpunkt recherchierte sie für eine größere Geschichte, in der es um Menschen wie uns beide gehen sollte: polnische Migranten, die in den 80er Jahren als Kinder nach Deutschland gekommen waren und ihre Herkunft im Assimilationsprozess teilweise oder vollständig verleugnet hatten. Damals dachte ich: Man kann das einfach so machen? Über die Polen schreiben, als wären wir ein Thema? Und eine Zeitung würde das drucken?
Meine Verwunderung kam nicht von ungefähr, denn schon vor der Veröffentlichung meines Romans Sitzen vier Polen im Auto hatte ich ein paar Dinge gelernt und verinnerlicht:
- Es gibt in Deutschland keinen Markt für die Geschichten polnischer Migranten, obwohl sie nach den Türken die größte Einwanderungsgruppe darstellen.
- Wer es in die Mainstream-Medien geschafft, aber einen polnischen Hintergrund hat, tut gut daran, sich rechtzeitig von ihm zu distanzieren. (Adam Soboczynski mag seine Herkunft in „Polski Tango“ thematisiert haben, besann sich dann aber doch auf seinen bildungsbürgerlichen Pullunder, weil sein Image keinen Schaden nehmen sollte.)
- Die Kombination der Schlagworte „Polen“ und „Migration“ ist in den Augen der meisten Verlage pures Marketing-Gift. Dafür, dass ich mein Buch in einem Publikumsverlag veröffentlichen konnte, musste ich mit einem schrecklichen Titel und klamaukiger Aufmachung bezahlen.
Eine polnische Migrationsgeschichte zu schreiben oder auch nur zu lesen, erfüllte mich lange Zeit mit einer eigentümlichen Scham. Durften wir das? Einfach so ans Licht treten, ohne dass uns jemand dazu aufgefordert hatte? Vielleicht war es gefährlich, sichtbar zu werden. Die Risiken waren Ausgelachtwerden oder Gleichgültigkeit. Dabei würde beides nur das Bild bestätigen, das wir von uns selbst hatten. Unsere Herkunft war entweder ein peinliches Ärgernis oder schlicht nicht der Rede wert.
Ein voller Erfolg: „Ich bin wer, den du nicht siehst“
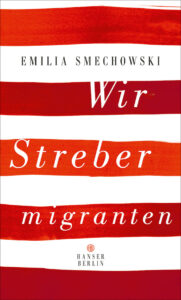
Emilias Geschichte ist einige Monate nach unserem Treffen unter dem Titel „Ich bin wer, den du nicht siehst“ in der taz erschienen — als Titelstory. Sie hat dafür mehrere Preise bekommen und der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck würdigte ihren Essay in einer Rede über Integration. Jetzt ist ihr Buch „Wir Strebermigranten“ erschienen und alle Medien berichten darüber: Das zdf, Die Zeit, der Deutschlandfunk. In einem Interview mit dem NDR hat Emilia erzählt, dass die Reaktionen auf ihren Artikel überwältigend waren und sie viele dankbare Mails von Menschen bekommt, die sich in ihren Schilderungen wiedererkennen. Die gleiche Erfahrung habe ich mit meinen Büchern gemacht. Und immer wieder der Satz: „Ich habe meine Geschichte immer unter den Teppich gekehrt.“
Woher kam bloß dieser Minderwertigkeitskomplex? Warum war es so selbstverständlich, den Deutschtürken Fatih Akin oder den Russlanddeutschen Wladimir Kaminer im Fernsehen zu sehen und so unvorstellbar, selbst zu einem Repräsentanten der deutsch-polnischen Geschichte zu werden?
Polen hat ein Image-Problem
In meiner Klasse gab es ein Mädchen, das mich konsequent ignorierte. Sie schaute an mir vorbei, wenn sie mich zufällig auf der Straße traf, sie lud mich nicht zu ihren Parties ein, und als der Lehrer vorschlug, sie und ich könnten doch mal eine Geschichte zusammen schreiben, fing sie an zu heulen. Wenn man etwas über sie sagen kann, dann dass sie ein sehr markenbewusstes Kind war. Bereits in der ersten Klasse trug sie nur Marken- und Designerklamotten und heute postet sie auf Facebook Fotos von Babyfüßchen in Converse Allstars. Ich war für sie unsichtbar, weil ich keine „Marke“ hatte. Ihr auf aussagekräftige Signale trainierter Kopf konnte einfach nichts anfangen mit einem „Mädchen aus Polen“.

Dieses Problem besteht bis heute in der medialen Repräsentation von Polen. Für russische Themen lässt sich mit einer formschönen, farbenprächtigen Matryoschka oder dem roten Stern des Kommunismus werben. Russland ist eine Marke wie Italien, das visuell ebenso wirkmächtig auftrumpfen kann, allein schon mit seiner Stiefelform. Polen hat keine Logos, abgesehen von der Fahne der Solidarność vielleicht, die aber weder Assoziationen mit gelungenem Urlaub noch mit osteuropäischer Exotik weckt. Solche Kleinigkeiten mag man wegen ihrer kapitalistischen Natur als unbedeutsam verwerfen, aber ich glaube, dass sie eine große Rolle für die öffentliche Wahrnehmung und Selbstwahrnehmung der Polen spielen.
Für viele von uns war dieser Umstand ein Segen. In Emilias Buch kann man lesen, wie ihre Familie eben dadurch, dass sie durch nichts auffiel, mit der Umgebung verschmelzen konnte. Für jeden Außenbetrachter eine Erfolgsgeschichte. Die Frage ist: War das jetzt gut? War es gesund? Emilia beantwortet diese Frage mit einem klaren Nein.
Auch unsichtbares Anderssein braucht Anerkennung
Mit einer gewissen Regelmäßigkeit erlebe ich auf Lesungen und während Podiumsdiskussionen folgendes Szenario: Während von den anwesenden Polen das Leiden an der Unsichtbarkeit diskutiert wird, meldet sich jemand mit dunkler Haut und sagt: „Das sind Luxusprobleme. Ich konnte mir nie aussuchen, ob ich gesehen werden möchte oder nicht.“ Ein Standpunkt, der uns immer wieder ein bisschen beschämt. Aber es gibt keinen Grund dafür! Ja, unsere Probleme sehen lächerlich aus für jemanden, der wegen seiner Hautfarbe diskriminiert wird. Aber bei dieser Diskussion geht es wirklich um etwas Anderes. Es geht m.E. darum, in seiner Andersartigkeit gesehen und anerkannt zu werden. Eine Andersartigkeit, die nach außen nicht sichtbar ist, die wir oft genug verbergen möchten, aber die wir dennoch alle in uns tragen. Wie sollten wir nicht anders sein?
Unsere Eltern sind Kinder des Sozialismus. Sie sind anders als die Eltern unserer Freunde, diese lockeren Alt-68er, die fröhlich gegen verkrustete Strukturen und für freie Liebe demonstrieren konnten. Sie sind in einer Gesellschaft großgeworden, die jede Abweichung bestrafte. In der Anpassung das Überleben garantierte und niemand eine „eigene Meinung“ riskierte. Auch wenn sie wussten, dass sie nun in ein freies Land gingen, hatten sie keine Vorstellung davon, wie diese Freiheit gelebt werden konnte. Die tiefen Überzeugungen und Werthaltungen von früher haben sie mit dem Passwechsel nicht einfach abgegeben. Emilia bringt das sehr eindringlich rüber, als sie von ihrem Auszug von zu Hause mit 16 erzählt oder von den Schlägen, die sie für unartiges Verhalten kassiert hat. Man spürt in jedem Satz die Enge und das Unbehagen, sein Leben in diesem Land gegen die Überzeugungen der Eltern zu gestalten, sich unter strafenden Blicken emanzipieren zu müssen.
Wir taten so, als ob sich unser Leben von dem unserer deutschen Freunde in nichts unterschiede, dabei lebten wir tatsächlich in zwei verschiedenen Welten. Ob Leistungsdruck oder moralischer Druck, unser Leben war häufig ein Kampf, den wir nicht gewinnen konnten. Und in der Schule behandelte man uns wie alle anderen, als hätten wir die gleichen Voraussetzungen wie unsere privilegierten Freunde mit ihrer Privatsphäre, ihren religiösen und sexuellen Freiheiten, ihrem Taschengeld und den erfüllten Konsumwünschen.
Die Scham ist überholt

Als Teenager hatte ich eine vielleicht bizarr anmutende Sehnsucht: Ich beneidete die sichtbaren Anderen, weil sie Fragen provozierten, die mir nie jemand gestellt hatte. Woher kommst du? Warum bist du so? Darf ich dich anfassen? Diese ganz normale Neugier, die von den meisten Nicht-Bio-Deutschen als übergriffig empfunden wird, genau die habe ich mir in meiner Einsamkeit gewünscht. Wäre es da nicht hilfreich gewesen, mit anderen Polen darüber zu sprechen? Ja, das Problem war nur, dass Polen nichts von anderen Polen wissen wollten. Das ändert sich erst jetzt, dank Menschen wie Emilia oder Vereinigungen wie „Zwischen den Polen“. Es sind junge, erfolgreiche und vor allem intelligente Menschen, die sich der Aufgabe angenommen haben, Polen in Deutschland sichtbar zu machen. Das ist insofern eine Herausforderung, als die Sichtbarkeit von Polen sich bislang auf „Kurwa!“ fluchende, besoffene Bauarbeiter beschränkte. Was sollen wir dem entgegensetzen? Ich sage: Nichts als unsere Köpfe.
Wir brauchen keine lauten Straßenfeste, wir brauchen keine folkloristischen Kostüme. Wir müssen, aus einer eher introvertierten Kultur stammend, nicht „aggressiv“ auftreten, um uns Geltung zu verschaffen. Was wir brauchen, sind mehr Menschen, die den Gegenpol zum fluchenden Bauarbeiter bilden und sich selbstbewusst zu ihrer Herkunft bekennen: Künstler, Literaten, Intellektuelle. Sich zu seiner Herkunft zu bekennen bedeutet dabei nicht, die Werbetrommel für Polen zu schlagen. Es reicht, nicht so zu tun, als wäre man gebürtiger Deutscher. Die Weigerung vor allem Intellektueller, ihre Herkunft zu thematisieren, war lange Zeit individuell verständlich, aber sie war auch immer politisch falsch. Jeder, der schwieg, zementierte die Vorurteile und überließ es dem Kurwa-Pöbel, das Polenbild hierzulande zu gestalten. Nur wenn wir die Scham aushalten, wird eine neue Sichtweise auf Polen möglich.
Vorbilder spielen eine Schlüsselrolle
Es ist bezeichnend, dass Polen in der deutschen Öffentlichkeit lange von Deutschen repräsentiert werden mussten. Es gibt erfreuliche Beispiele wie Steffen Möller und Matthias Kneip, aber auch unerfreuliche, wie „Justyna Polanska“, eine schreibende polnische Putzfrau, die sich später als Erfindung eines deutschen Journalisten entpuppt hat. Mir fehlten (und fehlen immer noch) Vorbilder. Das Problem der fehlenden Vorbilder ist universell. Ein Mädchen, das seine Freude am Programmieren entdeckt, kann von der Abwesenheit von Frauen in dieser Domäne genauso entmutigt werden wie ein Arbeiterkind, das im ersten Semester Philosophie nur von Bildungsbürgern unterrichtet wird. Sobald wir aber „Menschen wie uns“ in Rollen entdecken, in die wir noch hineinwachsen müssen, sind wir ermutigt und fühlen uns berechtigt, aktiv an der Gesellschaft teilzunehmen — mit allen Abweichungen und Besonderheiten, die wir mitbringen.
Ich kenne ein Mädchen, das vor drei Jahren aus Polen nach Deutschland kam. Aktuell ist sie 11 Jahre alt. Sie hat grüne Strähnen im Haar, liebt Haie und Wölfe und hasst nichts so sehr wie die Schule. Als ich sie kennen lernte, war ihr Deutsch katastrophal und sie hatte keine Motivation, es zu lernen. Das änderte sich, als ich ihr meine Geschichte erzählt habe. Staunend nahm sie zur Kenntnis, dass ein Mädchen wie sie, das kein Wort Deutsch sprechen konnte, heute Bücher schreibt. Und dass man das alles, was mit einem Kulturwechsel einhergeht, wirklich überleben kann. Ihr Deutsch ist immer noch nicht perfekt, aber es hat sich seitdem erheblich verbessert. Sie hat jetzt etwas, das sie vorher nicht hatte: Zuversicht.
Mein persönlicher Traum ist, dass ich mich irgendwann nicht mehr dafür rechtfertigen muss, Bücher über meinen Migrationshintergrund zu schreiben. Dass ich mir nie wieder überlegen muss, ob ich für ein Buch nicht lieber in die Haut einer Italienerin schlüpfe, um den Verlag zu überzeugen.
Unsere Geschichten sind wichtig. Nicht weil wir so wichtig sind, sondern weil die Zukunft wichtig ist. Weil wir mit unseren Geschichten gestalten, wie gut die kommenden Generationen mit sich und der Gesellschaft klarkommen werden. Wer diese Verantwortung einmal erkannt hat, wird seine Schamgefühle bereitwillig über Bord werfen, da bin ich mir sicher. Aber dafür braucht es auch moralische Unterstützung von Zeitungen, Verlagen und anderen Medien. Die endgültige Sichtbarwerdung muss jedoch durch uns selbst erfolgen: uns unsichtbare Polen.
Alexandra Tobor ist Autorin („Sitzen vier Polen im Auto“, „Minigolf Paradiso“) und Podcast-Produzentin. Sie verbrachte ihre ersten acht Lebensjahre in Polen, bevor sie mit ihrer Familie nach Deutschland aussiedelte. www.alexandratobor.de
Dies ist die leicht gekürzte Fassung eines Beitrags aus dem persönlichen Blog der Autorin.



